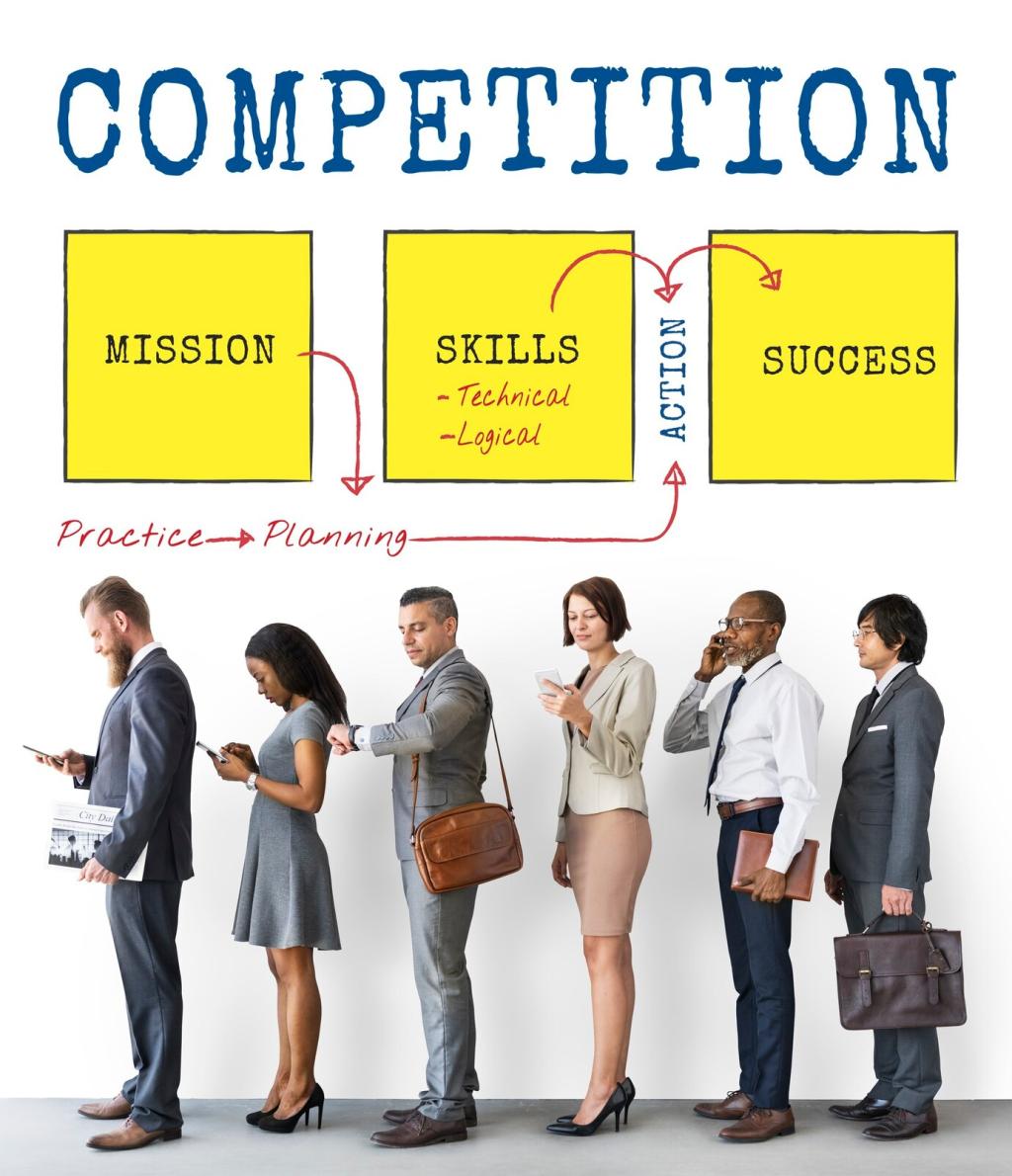Qualität zählt: Evaluierung und Unsicherheit ernst nehmen
RMSE bestraft Ausreißer stärker, MAE ist robuster, MAPE scheitert nahe Null. Wählen Sie die Metrik passend zur Verlustfunktion. Der Diebold‑Mariano‑Test klärt Signifikanz von Verbesserungen, doch nur, wenn die Validierung strikt auf Zeitstruktur achtet.
Qualität zählt: Evaluierung und Unsicherheit ernst nehmen
Expanding‑Window‑Schätzungen und rollende Ursprünge spiegeln reale Nutzung wider. So zeigen wir, wie stabil Modelle über Regimewechsel performen. Einfache Benchmarks wie naive Drift oder saisonales Naiv sind Pflicht, damit Fortschritte ehrlich messbar bleiben.
Qualität zählt: Evaluierung und Unsicherheit ernst nehmen
Dichteprognosen, Fan‑Charts und Vorhersageintervalle verhindern Scheingenauigkeit. Kombinieren Sie statistische Bandbreiten mit plausiblen Szenarien, etwa Energiepreisschocks oder Lieferkettenstörungen. Leser schätzen Transparenz – abonnieren Sie Updates, wenn wir unsere Unsicherheitsmodule weiter ausbauen.